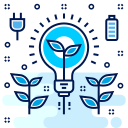This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Die Auswirkungen von Politik und Regulierung auf nachhaltige Mode
Die Modeindustrie steht an einem Wendepunkt, an dem nachhaltige Praktiken zunehmend durch politische und regulatorische Maßnahmen gestärkt werden. In Deutschland und weltweit entwickelt sich ein Rahmenwerk, das darauf abzielt, negative Umweltauswirkungen zu reduzieren und menschenwürdige Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen. Dieser Wandel ist von entscheidender Bedeutung, um den Herausforderungen von Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung und sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken, und eröffnet neue Chancen für Innovation und verantwortungsbewusstes Wachstum innerhalb der Branche. Die folgenden Abschnitte beleuchten die wichtigsten Aspekte, wie Politik und Regulierung die nachhaltige Mode in Deutschland beeinflussen.
Gesetzliche Grundlagen und ihre Bedeutung für nachhaltige Mode
Das Lieferkettengesetz: Verantwortung für soziale und ökologische Standards
Umweltschutzverordnungen und ihr Einfluss auf Materialien und Produktion
Zertifizierungen und Gütesiegel: Staatlich regulierte Orientierungshilfen
Der Einfluss europäischer Politik auf die deutsche Modebranche
Der Green Deal und seine Vorgaben für die Textilwirtschaft
Die EU-Textilstrategie und ihre Auswirkungen auf Produktion und Vermarktung
Handelspolitik, Zollregeln und nachhaltige Lieferketten
Herausforderungen für Industrie und Konsument*innen durch strengere Regulierung
Wirtschaftlicher Druck und Chancen für innovative Unternehmen